Inhaltsverzeichniss
Was ist Vibecoding?
„Vibecoding“ ist ein Begriff, den der bekannte Informatiker Andrej Karpathy Anfang dieses Jahres auf Twitter prägte. Er hat sich schnell als umgangssprachliche Bezeichnung für das Programmieren mithilfe von KI-Agenten (großen Sprachmodellen) etabliert. Dabei wird der Code nicht mehr Zeile für Zeile geschrieben – stattdessen gibt man der KI natürliche Sprachbefehle, um Code zu generieren, umzuschreiben oder zu debuggen.

In einem seiner Beiträge erklärte Andrej Karpathy, dass er nicht mehr über den eigentlichen Code nachdenkt – er konzentriert sich voll auf die Anwendungsidee und weist die KI einfach an, diese umzusetzen. Wenn ein Problem auftaucht, überlässt er die Lösung der KI. Diese kann in kürzester Zeit riesige Mengen Code erzeugen – mehr, als ein Mensch sinnvoll lesen könnte. Deshalb kontrolliert er auch nicht alles. Die Sprachmodelle (LLMs) sind inzwischen so leistungsfähig, dass er ihnen weitgehend vertraut – und meistens funktioniert es.
Aber ist das wirklich so? Oder doch übertrieben? Werden LLMs tatsächlich so mächtig wie "Jarvis" aus Iron Man, dem man nur sagt, was man braucht, und der Rest geschieht automatisch? Könnten alle Entwickler zu "Iron Man" werden? Viele würden sich das sicher wünschen.
Leider ist die Realität noch nicht ganz so weit. Dank über 70 Jahren Forschung in Deep Learning und neuronalen Netzen können Chatbots wie ChatGPT heute zwar Text, Code und Inhalte anhand natürlicher Sprache verstehen und generieren. Sie sind hervorragend zum Zusammenfassen von Informationen, Beantworten von Fragen, Erklären von Themen und zum Geben von Empfehlungen geeignet. Aber sie garantieren keine fehlerfreien Ergebnisse und keine perfekte Ausführung. Sie treffen kontextbasierte Entscheidungen, aber sie können Menschen noch nicht in allen Bereichen ersetzen.
Was ist der Stand der Softwareentwicklung heute?
Als OpenAI im November 2022 ChatGPT veröffentlichte, waren viele Menschen begeistert. Innerhalb der ersten fünf Tage zählte man über eine Million Nutzer. Grundlage war das Sprachmodell GPT-3.5 – das erste GPT-Modell von OpenAI, das leistungsfähig genug für echte Codegenerierung war.
Kurzer Überblick zur Entwicklung der GPT-Modelle:
- GPT-3.5 (2022): für Junior-Level-Aufgaben geeignet (Grundfunktionen, Code-Erklärungen, Übersetzungen)
- GPT-4 (2023): geeignet für größere Projekte, verbesserte Logik, bessere Tests und Dokumentation
- GPT-5 (2025): mittleres Entwickler-Niveau, stärkere logische Schlussfähigkeit
Der Engpass bleibt: Die Modelle sind noch nicht perfekt. Entwickler müssen den Code weiterhin überprüfen, besonders bei Sicherheit, Architektur und Performance. Außerdem neigt die KI dazu, Code unnötig zu verkomplizieren (Overengineering).
OpenAI ist natürlich nicht das einzige Unternehmen in diesem Bereich. In den letzten Jahren kamen viele neue Akteure hinzu:
- Anthropic (Claude) – starker GPT-4-Konkurrent
- Google mit dem multimodalen Modell Gemini
- Meta (LLaMA 2)
- Perplexity AI
- DeepSeek
- Mistral AI (Mistral Large)
- xAI (Grok) und weitere
Jedes dieser Unternehmen entwickelt seine Modelle stetig weiter. Alle haben eigene Stärken und Schwächen – und sie performen unterschiedlich je nach Anwendungsbereich.
Ein wichtiges Testfeld ist die Programmierleistung. Hier zeigen Benchmarks (z. B. swebench.com), dass Claude von Anthropic aktuell vorne liegt: stark bei Bugfixing, Multi-File-Projekten und Refactoring. GPT liegt knapp dahinter, ist aber besser in Multisprachen-Tasks (Python, Java, JS, Go, Rust). Das macht GPT besonders geeignet für Web-Komponenten, UI-Tasks und kleinere Skripte.
"In 5+ Jahren werden LLMs so weit sein, dass nur minimale Entwicklungskenntnisse benötigt werden. KI wird Lösungen vorschlagen können wie ein sehr guter Programmierer."
— Pavel Janko, CTO bei Moravio
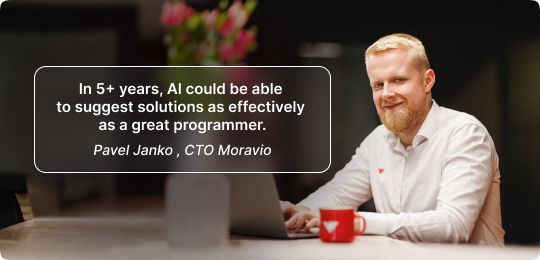
Neben den Modellen gibt es viele Tools, die das Coden erleichtern:
- GitHub Copilot
- Cursor
- Windsurf
- Replit
- Claude Code
- Codex
- Bolt
- Lovable
- V0
Sie unterscheiden sich in:
- verwendetes Modell
- Benutzerfreundlichkeit / IDE-Integration
- Preis
- unterstützte Programmiersprachen
- Kontextlänge
- Autonomie
- Zusammenarbeit
- Sicherheit / Guardrails
- Performance
Viele davon sind auch für Nicht-Entwickler nutzbar und dienen als Vibecoding-Plattformen. Sie helfen beim Lernen, bei einfachen Automatisierungen (z. B. Excel), Datenbearbeitung, Code-Erklärung oder Low-Code/No-Code-Projekten (z. B. Replit, V0).
Für komplexere Aufgaben wie Debugging, Integration von AI-Code oder die Bewertung von Vorschlägen braucht man aber weiterhin Fachwissen.
Wo passt Vibecoding in professionelle Softwareentwicklung?
Vibecoding ist definitionsgemäß ein kreativer, experimenteller und spielerischer Programmieransatz. Er eignet sich besonders für:
- Rapid Prototyping: Ideen testen, Prototypen oder Wireframes ersetzen
- Creative Coding: Kunst, Musik, Visualisierung etc.
- Hobbyprojekte: Lernen, Ausprobieren, Spaß
Vibecoding ermöglicht extrem schnelles Coden, ohne sich direkt um Effizienz, Sicherheit oder Best Practices zu kümmern.

Vibecoding bei Moravio
KI-generierter Code spart in der Designphase enorm viel Zeit. Das Prototyping neuer Funktionen oder Produkte (Proof of Concept) ist heute innerhalb weniger Tage möglich – anstatt in mehreren Wochen, abhängig von Größe und Komplexität. Gleichzeitig wird die Entwicklung auch für Menschen mit geringen oder gar keinen Programmierkenntnissen zugänglicher. KI hilft, Produktdetails besser zu durchdenken, sie klarer gegenüber dem Kunden zu präsentieren und gemeinsam einfacher auf das Endprodukt zu einigen.
Der Trend in der Softwareentwicklung geht derzeit zurück zum „spec-driven development“ – also dazu, genau festzulegen, wie ein Produkt oder eine Software funktionieren soll, bevor mit der eigentlichen Programmierung begonnen wird.
Das ist kein neuer Ansatz; er wird seit Jahren in unterschiedlicher Form genutzt.
Früher bestand die Herausforderung darin, dass Spezifikationen meist als lange Dokumente vorlagen, die gemeinsam mit dem Kunden abgestimmt und oft vertraglich gebunden waren. Diese Dokumente enthielten in der Regel Designs, Wireframes, API-Schemata und mehr.
Probleme von spec-driven development vor der KI:
- Sehr schwierig, jedes Detail im Voraus zu beschreiben
- Zeitintensiv
- Unterschiedliche Interpretationen durch verschiedene Beteiligte
- Schwer aktuell zu halten bei Änderungen
Dank KI und Vibecoding ist das heute viel einfacher und realistischer.
Entwickler oder Produktmanager können eine Anwendung in natürlicher Sprache spezifizieren – also das Dokument entsteht weiterhin – und die KI generiert beispielsweise eine React-App.
Diese sieht aus wie eine funktionierende Anwendung mit „hardcodierten Daten“ (ohne API-Anbindung). Sie ähnelt dem echten Produkt, Änderungen lassen sich leicht anpassen, aber sie ist noch keine produktionsreife Anwendung. Dasselbe Prinzip kann auch für kleinere Module oder einzelne Features genutzt werden.
Der Prototyp kann im gesamten Unternehmen geteilt werden, sodass alle Beteiligten die Geschäftslogik testen können. Das ist deutlich verständlicher als statische Grafiken oder klickbare Wireframes. Sobald die Spezifikation abgeschlossen ist, kann sie einfach in Entwicklungstasks übertragen werden und gibt der KI wesentlich mehr Kontext, um die echte Anwendung zu erstellen.
Für diesen Ansatz verwenden wir derzeit v0, für größere Projekte hingegen Tools wie Cursor, die größere Projektkontexte und Codebasen verarbeiten können. In der Entwicklungsphase arbeiten unsere Programmierer hauptsächlich mit Cursor.
Es ist einfach zu bedienen, bietet Zugriff auf den Projektkontext und ermöglicht den Wechsel des Modells je nach Feature – je nachdem, welches Modell sich am besten für die Aufgabe eignet.
Die Modelle, die Cursor antreiben, können Seiten, Detailansichten, modale Fenster und typische Webfunktionen erzeugen. Sie unterstützen auch bei der Erstellung automatisierter Tests, beim Styling, der Datenanzeige und ähnlichen Aufgaben. Der generierte Code ist meist klar und effizient.
Entscheidend ist, präzise und zielgerichtete Prompts zu verwenden, gesunden Menschenverstand anzuwenden und den generierten Code sorgfältig zu prüfen, bevor er genutzt wird.
Vor der KI mussten Senior Developer die gesamte App-Architektur entwerfen, die Funktionsweise planen, alle Komponenten definieren und oft blieb wenig Zeit zum eigentlichen Coden – insbesondere, wenn sie auch ihr Team koordinieren mussten. Heute kann KI Code auf dem Niveau eines Mid-Level-Entwicklers generieren. Was sie jedoch noch nicht kann, ist den gesamten App-Kontext zu erfassen, Funktionen effizient zu verknüpfen und langfristig wartbaren Code zu gewährleisten.
Das verändert auch die Teamgrößen. In der Regel reicht heute ein Senior Developer, der mit KI arbeitet. Teamarbeit bei größeren Projekten ist weiterhin sinnvoll – aber nur, wenn alle an unterschiedlichen Teilen arbeiten, sonst sinkt die Effizienz.
Neue Libraries und Tools (z. B. Cursor Rules) entstehen schnell und helfen, den Anwendungskontext und konsistenten Code beizubehalten. Man könnte sagen: Co-Development ist bei kleineren Projekten weniger effektiv als früher.
„Entwickler brauchen heute eine neue Kernkompetenz: die Fähigkeit, große Sprachmodelle (LLMs) effektiv zu steuern.Das bedeutet, Spezifikationen klar zu beschreiben, der KI genau zu erklären, was gebaut werden soll, und ein paar Codebeispiele bereitzustellen, damit sie konsistente und verlässliche Ergebnisse liefern kann.“
— Pavel Janko, CTO bei Moravio
Bei Moravio nutzen wir Vibecoding ausschließlich in der Designphase, wo der Fokus auf Produkt, Nutzerfluss und Businesslogik liegt. In der eigentlichen Entwicklung verfolgen wir das Gegenteil des Vibecoding-Stils – einen klar strukturierten Prozess, bei dem wir genau wissen, was wir bauen und wie. KI wird dabei nur verwendet, um Code gemäß unseren Spezifikationen zu generieren.
Unsere Entwickler setzen KI auch in anderen Bereichen effizient ein. Sie hilft, komplexe Themen zusammenzufassen und zu verstehen (z. B. „Erkläre, wie Verschlüsselung und Kryptografie funktionieren“) – Themen, deren Einarbeitung sonst viele Tage dauern würde. So können neue Inhalte viel schneller erlernt werden als durch reine Internetrecherche.
KI verändert die Arbeitsweise – nicht nur für Entwickler und Designer, sondern auch für Tester. Modelle können Tests in Tools wie Cursor generieren, oder es gibt neue Tools, die Tests anhand von Akzeptanzkriterien automatisch durchführen.
Unsere Tester nutzen KI bereits, um bessere und umfangreichere Tests zu schreiben – mit Tools wie Visual Studio Code, Copilot, Claude.ai und natürlich ChatGPT.
.jpg)
Risiken, die wir sehen
- Flut von minderwertigen Anwendungen, die zwar funktionieren, aber keine saubere Struktur oder ausreichende Sicherheit haben und schwer zu warten sind.
- Overengineering – KI kann mehr Code erzeugen, als tatsächlich nötig ist.
-
- Trügerische Einfachheit – die Illusion „Jeder kann programmieren“ verdeckt die eigentliche Komplexität(kann z. B. dazu führen, dass Produktionsdaten gelöscht werden – siehe Hot_Bologna_Sandwich, Kommentar auf Reddit, 19. August 2025)
- Sicherheitslücken – KI priorisiert keine Architektur-Standards oder gesetzliche Vorgaben (Compliance).
- Abhängigkeitsrisiko – Teams, die sich blind auf KI verlassen, stoßen irgendwann an Grenzen, die sie allein nicht überwinden können.
- Abhängigkeit von Tools und Modellen – wenn Anbieter ihre Preisstruktur ändern oder Einschränkungen einführen, wirkt sich das direkt auf Entwicklungsteams aus.
- Zeitverlust statt Zeitersparnis, wenn Entwickler die Grenzen der KI nicht verstehen und versuchen, komplexe Anwendungen mit ihr zu bauen
(z. B. Kai Lentit, YouTube, 8. April 2025 – Senior Developer versucht zu vibecoden)
oder nicht über ausreichend Programmierkenntnisse verfügen.
Wie geht es weiter mit Vibecoding?
- In 5+ Jahren könnte KI einen Großteil der Programmieraufgaben übernehmen.
- Die Rolle von Entwicklern wird sich hin zu Prompting, Systemdesign und kritischem Review verschieben.
- Senior Developer werden noch wertvoller als bisher.
- Unternehmen, die KI-Geschwindigkeit mit menschlichem Know-how kombinieren, werden erfolgreich sein.
Unsere Sicht bei Moravio
- Vibecoding ist mächtig – aber nur in den richtigen Händen.
- Bei Moravio setzen wir es gezielt in der Prototyping- und Explorationsphase ein.
- Für die eigentliche Produktentwicklung kombinieren wir KI mit der Erfahrung unserer Senior Developer, um Sicherheit, Skalierbarkeit und Wartbarkeit zu gewährleisten.
- Wir haben keine Angst vor neuen Tools und sind bereit, mit KI zu experimentieren. Der wahre Wert unseres Teams liegt in dem, was KI nicht ersetzen kann:
- das Verständnis für die tatsächlichen Nutzerbedürfnisse
- die Gestaltung einer benutzerfreundlichen, reibungslosen Oberfläche
- die Auswahl der richtigen Architektur und Struktur
- das Schreiben von hochwertigem, verständlichem Code
- das Abdecken der Anwendung durch automatisierte, sinnvolle Tests
- die Gewährleistung von Sicherheit
Bei Moravio nutzen wir die Kraft der KI, um Innovation zu beschleunigen – ohne Kompromisse bei Qualität, Sicherheit oder Nutzererlebnis.








.png)


.png)

.png)



.webp)





